|
|
|
|
|
|
|
ÜBER DÜRERS MELENCOLIA I
|
|
|
|
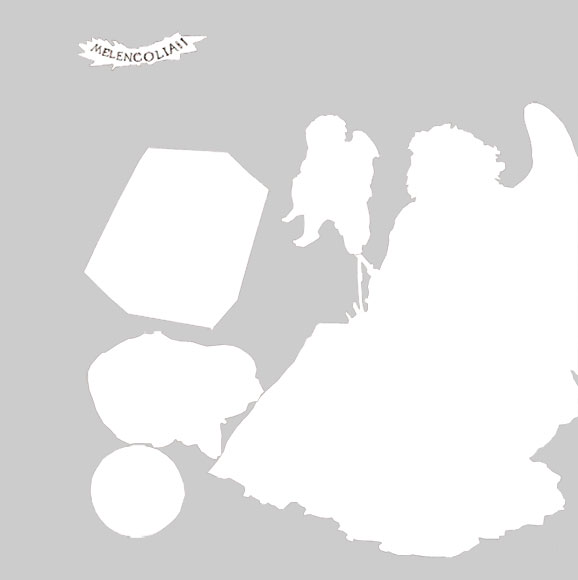 |
|
| Albrecht Dürer. Melencolia I (1514). Kupferstich. Bild Maske / Digitale Freistellung |
|
Das Bild
Der von Dürer selbst mit „Melancholie“ bezeichnete Kupferstich aus dem Jahre
1514 war und ist Gegenstand zahlreicher kunst- und kulturhistorischer
Untersuchungen. Sie verweisen übereinstimmend auf die Umwertung der
Melancholie von einem krankhaften Gemütszustand zur melancolia generosa, die
zur Zeit der italienischen Frührenaissance unter dem Einfluß der
Wiederentdeckung der Neuplatonischen Schriften stattgefundenen hat. Dafür
steht in erster Linie Marsilio Ficino mit seiner Schrift „ De triplici vita “. Darin
beschrieb er diese spezifische Ausprägung der Melancholie nicht als Übel, das
dem Menschen entweder von Natur aus, seiner astrologischen Bestimmung nach
oder durch eine der Gelehrsamkeit gewidmete Tätigkeit zukäme, sondern als
Wesensmerkmal des schöpferischen und nach höherer Einsicht strebenden
Menschen.
Bildbeherrschend ist die Gestalt eines sitzenden, weiblich gewandeten Engels.
Seine selbstvergessene Haltung gibt der geistigen Anstrengung eines grübelnden
Denkens Ausdruck. Der scharfe Blick geht in die Weite einer Welt der inneren
Vorstellung. Der umkränzte Kopf stützt sich schwer auf die zur Faust gebildete
Linke. Die rechte Hand hält einen geöffneten Zirkel. Achtlos an einem losen Band
hängen die Insignien des sozialen Geltens – Schlüssel und Geldbeutel – am
Gürtel des schweren Gewandes, dessen Faltenwurf die innere Gefühlsbewegung
spiegelt.
Mit Zirkel, Kreis und Kugel wird eine Weltsicht zeichenhaft, die auf die
Vorstellung einer göttlichen, kosmischen Ordnung gründet. Dürer zitiert
ikonographische Metaphern, die sich leitmotivisch durch die philosophischen
Schriften der italienischen Frührenaissance, der florentinisch-platonischen Schule
des Marsilio Ficino und das Werk des Pico de la Mirandola ziehen. (siehe:
Klibansky,R., Panofsky, E., Saxl, F.: Saturn und Melancholie und Thumfart, A.:
Die Perspektive und die Zeichen, München 1996).
Ein Stern, der den dunklen Nachthimmel hell überstrahlt, nimmt in der Zeichnung
die entfernteste stereometrische Position ein. Von ihm aus läßt sich bis in den
Mittelpunkt der im Vordergrund, links unten am Boden liegenden Kugel eine
Gerade ziehen. Diese durchläuft dabei das Zentrum der Konstruktion des
Polyeders ebenso wie das Herz des dösenden Hundes. Himmelskörper, Polyeder
und Kugel in Beziehung zueinander gesetzt, könnten für das Wechselspiel der drei
Seelenzustände stehen, die Ficino unterscheidet: ratio, imaginatio und mens:
Vernunft, Phantasie und Kontemplation. Was aber bedeutet, in diesen
Zusammenhang gebracht, das hundähnliche Tier?
Die menschliche Seele, solange ihre Tätigkeit auf die Erhaltung des Lebens
gerichtet ist, bleibt dem Vegetativen und Animalischen verhaftet. In ihrer
Fähigkeit zu abstraktem, von der Welt der Erscheinungen losgelöstem Denken,
gewinnt die Seele erst ihre Menschlichkeit. Doch dann schließlich, wenn in reiner
Kontemplation versunken alles Wollen, alles praktische und kalkulatorische
Denken ruht, dann wachsen der menschlichen Seele Flügel und sie erfährt sich in
ihrer göttlichen Natur. Doch eine Tätigkeit des Geistes ohne sinnliche
Wahrnehmung, also ohne jene Sensualität, die auch dem Tier eigen ist, kann
niemals gelingen, denn sie bliebe gestaltlos und leer. Erst durch sinnliche
Anschauung gelangt der menschliche Geist zu jener bestimmten Begrifflichkeit,
die ihm ein Denken überhaupt ermöglicht. Im Denken besitzt der Mensch aber die
Fähigkeit vom Konkreten zu abstrahieren. Dadurch gelangt er zu Anschauungen
einer Welt symbolhafter Zeichen, die losgelöst von jeder Erdenschwere, ihm den
Ausblick auf eine Welt eröffnen, in der die unabänderlichen Gesetze der
kosmischen Harmonie sichtbar gestaltend wirken. In diesem Prozeß geistiger
Erkenntnis ereignet sich die Transsubstation von Maß und Zahl zu jener wahren
Schönheit, die jenseits aller Zweckbestimmung sich alleine selbst genügt.
Hartmut Böhme hat in seiner Deutung der Dürer’schen „Melancholie“ davon
gesprochen, daß es sich bei diesem Bild um ein Denkbild handele, welches das
Denken selbst zum Gegenstand hätte. Zweifellos trifft er damit das Wesentliche,
jedoch scheint mir, daß der Nürnberger Meister eine präzisere Aussage gemacht
hat.
Um dem, was gemeint sein könnte auf die Spur zu kommen, ist es sinnvoll noch
einmal auf Pico de la Mirandola zurückzukommen. Er bemüht das Sinnbild der
Jakobsleiter, die dem Menschen den Weg der Erkenntnis weist. Wenn die
menschliche Seele schließlich die siebente Stufe der Leiter erklommen habe, so
würde sie dort den „ angelo terrestre“ erreichen. Im Aufstieg („per sei gradi“)
gelänge der Seele die Metamorphose zu einem engelhaftem Sein, sofern es ihr
gelänge, jedes zweckgerichtete Wollen und Tun zu überwinden. Weil wahres
Menschsein sich erst in diesem Streben nach solch Glück verheißender Erkenntnis
erfülle, müsse der Mensch den Weg der Läuterung gehen.
Hier stellt sich ihm aber ein unlösbarer Widerspruch in den Weg: einerseits
nämlich muß der Mensch, wenn er seine Seele auf die Reise in die höheren
Regionen schicken will, den animalen Teil seiner Empfindungen zurücklassen.
Andererseits jedoch, solange der Mensch dem Leben verbunden ist, kann und darf
er seine Kreatürlichkeit niemals verleugnen. Denn er verlöre mit ihr sein Leben.
Den Menschen hält, auch wenn sein Geist noch so hoch auffliegen mag, seine
Tiernatur auf der Erde fest, so müde und schläfrig sie auch sein mag. In diesem
Sinne mag man es verstehen, daß Dürer dem einzigen tatsächlich realen irdischen
Lebewesen, einem alten, müden Hund nämlich, der eher schläft als wacht, im
Bild einen Platz zuweist.
Die auffällige Unordnung des auf dem Boden herumliegenden Handwerkzeugs,
das man leicht als das eines Zimmermanns identifizieren kann, erzeugt im
Betrachter die Vorstellung, daß irgendein überraschendes Ereignis einen
überstürzten Abbruch der Arbeit erzwungen hat. Der Blick und die Gesichtszüge
der Engelsgestalt scheinen von einer fieberhaften inneren Erregung ergriffen, die
ganz im Gegensatz sowohl zu seiner Ruhe ausstrahlenden Körperhaltung, als
auch zu der Stille der Nachtstimmung des ganzen Bildes steht.
Ob wir einen Innenraum sehen, oder eine Szene unter offenen Himmel, bleibt
ebenso ungewiß wie die Frage, ob hier ein sakrales oder säkulares Bauwerk
errichtet wird. Naheliegend ist, daß seine Unfertigkeit ebenso zeichenhafter Natur
ist, wie alles, was hier ins Bild gesetzt ist. Erinnernswert ist, daß architektonische
Metaphern in der philosophischen Literatur der Renaissance von Nikolaus von
Kues bis hin zu Giordano Bruno der Vorstellung vom Denken und dem
Erinnerungsvermögen Gestalt geben.
Bestimmt ist es auch nicht zufällig, daß es ausgerechnet eine siebenstufige Leiter
ist, die rückwärts an einem vierkantigen architektonischen Segment lehnt. Auf
dessen Vorderseite ist das sechzehnzellige, magische Quadrat eingelassen, das
dem Jupiter zugeschrieben ist. Seine unterste Zeile (4-15-14-1) mag man als
Wiederholung der Signatur lesen, wobei die beiden mittleren Ziffern das
Entstehungsjahr des Stiches (und das Todesjahr der Mutter des Künstlers)
bezeichnet, während die äußeren für die Initialen (4=D; 1=A;) des Künstlers
stehen. Über dem Quadrat: eine Glocke und, ihr benachbart, ein halbgefülltes
Stundenglas, für gewöhnlich sichere ikonographische Zeichen der Vanitas. Hier
aber könnten sie ebenso gut den Stillstand der Zeit im subjektiven Zeiterleben
bedeuten. Seitwärts an der Säule, in einer Achse mit dem hellstrahlenden
Himmelskörper, der von einem vielfarbigen Regenbogen umgeben ist, ist die dem
Saturn zugeordnete Waage befestigt, deren leere Schalen sich im Gleichgewicht
halten. Unter ihr und auf der räumlichen Mittelachse des Stiches, zwischen dem
geheimnisvollen Polyeder und der Gestalt der sinnenden, bildmächtigen
Engelsgestalt, sitzt auf einem Mühlstein ein kleiner Putto, der mit seinem Griffel
auf einer Tafel kritzelt. Mit seiner Gestalt, die in mühevolles Tun versunken
scheint, hält Dürer dem Betrachter ebenso freundlich wie ironisch einen Spiegel
vor. Freundlich deshalb, weil der Künstler das Menschlein beflügelt zeichnet, und
darum ironisch, weil er das bekannte Bild von den sich schwer und zwanghaft um
ihre eigene Achse drehenden Mühlsteinen umkehrt, indem er das werkelnde
Federgewicht auf einen außer Gebrauch gesetzten Mühlstein setzt.
Die eigentliche Denkfigur des Bildes aber ist der eigentümliche Polyeder, der
proportional zu den anderen Gegenständen das Maß der Verhältnismäßigkeit
sprengt. Heinrich Wölfflin („Die Kunst Albrecht Dürers“ 1905/1926) stellt zwar
fest, daß der Block so auffällig im Bild stehe, „daß man ihm gar nicht ausweichen
kann“, beklagt aber, daß er keinerlei mathematisches Problem enthielte, „etwas
wie die Quadratur des Kreises“. Er kann an ihm nichts entdecken, was auf
irgendeine schwierige Aufgabe hinweise. Hier bin ich ganz anderer Meinung.
Daß er die zentrale Position des Bildes einnimmt, erscheint mir alles andere als
zufällig. Sie fordert den Betrachter geradezu heraus, seine eigentümliche Form zu
enträtseln. Sechs identische, zu fünfeckigen Flächen abgestumpfte Rhomboide
und zwei sich gegenüberliegende gleichseitige Dreiecke bilden sein
Oberflächengitter. Seine kristalline Struktur erweist sich als weder naturhaft, noch
in seiner Regelmäßigkeit auf ein Modell platonischer Körper zurückführbar.
Dennoch teilt er mit ihnen die Eigenschaft, daß alle seine Ecken von seinem
Konstruktionsmittelpunkt gleichweit entfernt sind und von einer Kugelhülle
umschlossen werden könnten.1
Was diesen zwölfeckigen Polyeder aber ganz grundlegend von einem platonischen
Körper unterscheidet, ist etwas anderes, nämlich die Tatsache, daß seine
Konstruktion auf einer freien Erfindung beruht. Die platonischen Körper dagegen
sind Ergebnis der Entdeckung der ihnen zugrunde liegenden geometrischmathematischen
Gesetzmäßigkeiten. Dieser Unterschied führt, meines Erachtens,
ins Zentrum dessen, was Dürer mit dem Bild zum Ausdruck bringt. Dürer stellt
mit diesem Polyeder ein deutliches Zeichen in den perspektivischen Raum, das zu
lesen ist nicht nur als ein Werk, das die göttliche Natur der menschlichen Seele
beweist, sondern auch die individuelle Erfindungsgabe des schöpferischen
Geistes. Mit der Erfindung und der perspektivisch exakten Konstruktion des
Polyeders – nach Schuritz (in: Die Perspektive in der Kunst Albrecht Dürers)
übrigens die einzig wirkliche stimmige Perspektivzeichnung des Stiches – gibt
Dürer Auskunft über sein eigenes Selbstverständnis als Künstler. In dem kleinen
Feuer, das hinter dem Block, dem Betrachter aber gut sichtbar, auf dem Sims
steht und einen Krug erhitzt, sehe ich ein Wort Dürers aus der Vorrede des
Entwurfs zu einem „Lehrbuch der Malerei“ aus dem Jahre 1508/09 verbildlicht: „
Ich mein, ich wöll hie ein klein Feuerle anzünden. So ihr all Mehrung mit
künstlicher Bessrung darzu tüt, so mag mit der Zeit ein Feuer daraus geschürt
werden, das durch die ganze Welt leucht.“
Veranschaulicht an den symbolhaften Wandzeichen (Quadrat, Glocke, Uhr und
Waage), vor allen Dingen aber mit dem raummächtigen kristallinen Körper,
demonstriert Dürer die von ihm eingeforderte Verbindung von philosophischreligiöser
Weltschau mit technologischer Naturbeherrschung.
Das, was der Stich aber eigentlich auf den Begriff bringt, enträtselt sich erst in der
Betrachtung des Bildhintergrundes. Dieser gewährt die Aussicht auf eine ruhige
See, die von einer sanft sich schwingenden Küste begrenzt wird, an der ein kleines
Hafenstädtchen liegt. Darüber wölbt sich ein Nachthimmel, erhellt von einem
astralen Himmelskörper. Merkwürdigerweise erscheint dort auch ein vielfarbiger
Regenbogen, der doch eigentlich ein Tagzeichen ist, und ein geschwänztes und
geflügeltes Fabeltier, das ein vielzackiges Schriftband in den Klauen hält. Auf ihm
ist zu lesen, worauf das Bild thematisch zielt, „MELENCOLIA I“. Mancher, der
sich in der Deutung des Bildes versucht hat, hielt das strahlende Himmelslicht für
den Saturn, der in der astrologischen Tradition als Urheber des melancholischen
Temperaments gilt. Andere haben aus der einseitigen Bündelung des Lichtes, das
von diesem Himmelskörper ausgeht, darauf geschlossen, daß es sich um einen
Kometen handeln müße. Nach altem Volksglauben kündigte sich mit seinem
Erscheinen ein Unglück an. Im Sinne des oben gesagten jedoch will mir scheinen,
daß alle drei Himmelserscheinungen zusammen, also: Stern, Bogen und
geflügeltes Nachttier, Teil eines einzigen phantastischen Gesichtes sind, das uns
den Schlüssel für das Verständnis des ganzen Bildes in die Hand gibt. Auf den
nächtlichen Himmel projiziert Dürer das Bild einer schicksalhaften Vision. Die
plötzliche Blendung des Bewußtseins durch einen beinahe katastrophisch auf das
Bewußtsein einstürzenden, übermächtigen Gedanken, der dem schöpferischen
Menschen oft zeitlebens als Leitstern seinen Weg weist, - dieses überwältigende
innere Erleben wird hier als kosmisches Ereignis sichtbar. Der Regenbogen, ist
hier nicht nur Symbol der zwischen Himmel und Erde wiederhergestellten
Harmonie, sondern ganz konkret auch himmlisches Zeichen. Es steht
emblematisch nicht nur für die Metaphysik der Farbe und damit schlechthin für
die Kunst der Malerei, sondern symbolisiert auch den Brückenschlag zwischen
Himmel und Erde, die Erneuerung des Bundes zwischen Gott und den Menschen
als eigentliche Bestimmung der Kunst. Welchen Preis der schöpferische Mensch
für seine Berufung zu entrichten hat, darüber belehrt die Inschrift des
Spruchbandes.
Thematisiert ist in dem Bild also nicht nur das Denken schlechthin, sondern jenes
besondere, das dem schöpferischen Menschen durch seine Initiation zum Künstler
schicksalhaft aufgegeben ist.
Dürer’s „Melancholie“ steht am Anfang einer historischen Epoche, in der das
Selbstverständnis des Künstlers davon bestimmt ist, daß er in allen Belangen
seines künstlerischen Schaffens nur sich selbst Rechenschaft abzulegen habe.
Weil seine Berufung zum Künstlertum göttlichen Ursprungs sei, könne es keine
höhere irdische Instanz geben, die sich ein Urteil über sein Werk anmaßen dürfe.
In dieser Botschaft scheint mir die Lösung des berühmten Rätselbildes zu liegen.
Daß sich Dürer selbst zur Bedeutung seines Stichs nur höchst kryptisch geäußert
hat, scheint nicht verwunderlich. Gemeinhin hätte man sein unverstelltes
künstlerisches Sendungsbewußtsein als lästerliche Anmaßung empfunden. Um
möglicherweise solchem Vorwurf zuvorzukommen, stellt der Künstler die Leiden
verheißende Überschrift akzentuiert ins Bild. Die Hervorhebung der negativen
Auspizien auf ein zum Künstler geborenes Dasein mag man durchaus als
notwendige Camouflage deuten. Den gebildeten, im Geist der Renaissance
geschulten Zeitgenossen, dürfte jedoch die eigentliche Botschaft kaum entgangen sein.
Schon in seinem „Lob der Malerei“ (1512) konnte man recht deutlich lesen:
„Die Kunst des Molens kann nit wohl geurteilt werden dann allein durch die, die do selbs
gut Moler sind. Aber fürwahr, den anderen ist es verborgen, wie dir ein fremde Sprach.“
„Die groß Kunst der Molerei ist vor viel hundert Johren bei den mächtigen Künigen in
großer Achtbarkeit gewesen, dann sie machten fürtrefflichen Künstner reich, hieltens
wirdig, dann sie achteten solche Sinnreichigkeit ein gleichförmig Geschöpf noch Gott.
Dann ein guter Maler ist inwendig voller Figur, und obs müglich wär, daß er ewiglich
lebte, so hätt er aus den inneren Ideen, dovan Plato schreibt, albeg etwas Neus
durch die Werk auszugießen.“
In zwei Hauptwerken der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts spielt Dürer’s
Stich eine gewichtige Rolle: im „Doktor Faustus“ von Thomas Mann und in der
„Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss.
Für Adrian Leverkühn ist die Dürer’sche Melencolia Sinnbild für die Verbindung
einer spekulativ gnostischen Weltsicht mit dem eigenen kreatürlichen Leiden, das
im künstlerisch musikalischen Werk zur Einheit gezwungen werden muß.
Peter Weiss deutet dagegen das Blatt als dramatische zugespitzte Darstellung
eines ereignishaften Erlebens, das den Menschen entweder vernichtet oder
„verrückt“, das aber eben auch Initiationserlebnis des Künstlerischen sein kann.
Schon bei der ersten Lektüre des Weiss’schen Romans hat mich ein dort
auftauchendes Motiv, die Zusammenführung dreier, höchst unterschiedlicher
Elemente, elektrisiert: die psychische Erkrankung der Mutter des Ich-Erzählers,
Hölderlin’s später Hymnus „Mnemosyne“ und Dürer’s „Melancholie“. Ich möchte
das, was mich da gepackt und seither nicht mehr losgelassen hat, mit den
folgenden Zitaten aus dem Roman verständlich machen.
„Eine besondre und seltne Konstitution gehöre dazu, in allen Vorgängen die letzten Folgen
zu erkennen, ungeheuer gefährdet seien Menschen, denen dies gegeben sei, denn sie
könnten sich, obgleich sie weiter und tiefer schauten als wir, in unsrer Welt nicht mehr
behaupten. Für diese Menschen gebe es nur zwei Möglichkeiten, entweder den immer
hermetischer werdenden Rückzug in ihre Halluzinationen, in denen die Vereinsamung
ihnen allmählich den Sinn für das Zusammensein mit andern Menschen raube, oder den
Weg in die Kunst.“ (III, 132)
„Die Kunst, sagte Hodann, setze dort ein, wo alle Philosophien und Ideologien aufhören,
sie entspringt der Entelechie, jener rätselhaften Kraft, die allem Lebenden innewohnt, um
es zu steuern und, erleide es Schaden, wieder herzustellen, zu den mnestischen Funktionen
gehöre sie, die im Hirn, in den Zentren des Visuellen und Akustischen, der örtlichen und
zeitlichen Orientierung, alles Vernommene bewahren und es uns, auf Nervenreize hin,
zugänglich machen, ohne daß, beim Sezieren, Spuren dieser aus Erinnerungen bestehenden
Denkfähigkeit entdeckt worden wären. Die Mneme, beschützt von der Göttin Mnemosyne,
leite uns zu den künstlerischen Handlungen an, und je mehr wir von den Erscheinungen
der Welt in uns aufgenommen hätten, zu desto reicheren Kombinationen könnten wir sie
bringen, zu der Vielfalt eben, aus der sich der Stand unserer Kultur ablesen lasse.“
(III, 134)
„Kunst sei gleichbedeutend mit Humanität, hatte Hodann gesagt, denn ohne diese
Anteilnahme am Leben, an diesem ständigen Kampf gegen die Selbstaufgabe, ohne diesen
Drang, die Situation von immer wieder neuen Gesichtspunkten aus zu erhellen, ließe sich
die weittragende Wirkung der Kunst nicht verstehen. Die Antworten der Kunst seien
immer ungeheuerlich gewesen, denn, als einzige, wagten sie es, die Thesen der Zeit zu
widerlegen, stets seien sie, auch im Schutz der Verkleidung, ihrer Gegenwart vorausgeeilt
und hatten den Zerrbildern die Wahrheit entgegengestellt.“ (III, 134)
In seinen kunsttheoretischen Schriften setzt sich Dürer mit den moralischethischen
Voraussetzungen des künstlerischen Schaffens auseinander und
begründet seine „Vier Bücher von menschlicher Proportion“ mit der
Notwendigkeit die Begrifflichkeit des ästhetisch Schönen von einem vagen
Geschmacksurteil auf eine mathematisch-geometrische Grundlage zu stellen. Er
möchte damit das Kunstschöne mit dem göttlich Wahren in Übereinstimmung
bringen. In den harmonischen Proportionen durch die sich das Schöne gestaltet,
spiegelt sich, in Maß und Zahl faßbar, das göttliche Wesen.
„ ..... Die vergleichlichen Ding, eins gegen dem anderen (= die wohlproportionierten Dinge
- Anm. der Herausgeber), sind schön, und das Unnütz ist zu vermeiden. Aber der Nutz ist
ein großer Teil der Schönheit. (Dürer: aus den Entwürfen zum „Lehrbuch der Malerei“
Von der Malerei und von der Schönheit)
Das solcherart Schöne erweist sich aber auch nützlich, weil es das Gute vom
Bösen scheidet. Kunst entfaltet, da sie gesetzten Regeln folgt, eine moralische
Kraft, die den Menschen bessert, indem sie ihn das Gute vom Schlechten zu
scheiden lehrt.
„ ......wiewohl etlich grob Menschen die Künst hassen, türn ( = sich getrauen zu) sagen, sie
gebär Hoffart. das kann nit sein. Dann Kunst gibt Ursach der demütigen Gutwilligkeit,
Aber gewahnlich die nichts künnen, wöllen auch nichts lernen, verachten die Künst, sagen,
es kumm viel Übels darvan und etlich seien ganz bös. Das kann aber nit sein. Dann Gott
hat alle Kunst beschaffen, dorum müssen sie all genadenreich, voll von Tugend und gut
sein. Dorum halt ich alle Künst für gut. Ein Schwert, das scharpf und güt ist, mag das nit
zum Gericht oder Mord gebraucht werden? Ist dorum das Schwert besser oder böser? Also
in den Künsten........“ ( ebendort: - Vom Nutzen des Wissens)
„ ......... Dann ist der künstlich Mensch frumm aus Natur, so meidet er das Bös und würkt
das Gut. Dorzu dienen die Künst, dann sie geben zu erkennen Guts und Bös.......“
(ebendort: Vom Nutzen des Wissens)
Dürers künstlerischer Ethos gründet sich also sowohl auf die Frömmigkeit des
Künstlers und seine Demut vor Gott, als auch gleichermaßen auf sein
schöpferisches Genie, das ihn zum Mittler zwischen Gott und den Menschen
bestimmt und ihm eine priesterliche Sendung auferlegt. Ganz im Sinne sowohl
des Geistes der florentinischen neuplatonischen Schule, als auch des
Aufbegehrens des anbrechenden reformatorischen Zeitalters, weiß sich der
Künstler in seiner Arbeit nur noch seinem eigenen Gewissen und seinem Gott
verantwortlich.
Die dritte Instanz aber, die über künstlerische Arbeit urteilt, und die im weiteren
Verlauf der Geschichte mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, ist ihr pekuniärer
Erfolg. In dem Maß, in dem es dem Künstler gelingt sich von der klerikalen
Nötigung und feudalen Abhängigkeit zu lösen, bestimmen die Gesetze des
Marktes über die gesellschaftliche Stellung des Künstlers. Kunst als Ware der
besonderen Art changiert fortan zwischen den Polen Luxus und Gebrauch,
Belehrung und Unterhaltung, Besinnung und Betäubung, Aufklärung und Rausch.
Gut oder böse, richtig oder falsch, nützlich oder überflüssig, schön oder häßlich,
sind zu unentscheidbaren Kategorien geworden.
Schluß
Als Dürer sein Recht einforderte, seine Arbeit nur seinem eigenen und keinem
anderen letztinstanzlichen Urteil zu unterwerfen, stand die europäische
Kunstgeschichte, die aufs engste mit der Geschichte der Emanzipation des
Bürgertums verbunden ist, an ihrem Beginn. Ebenso stand auch die Entwicklung
jener gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung erst am Anfang, die sich
heute, nach Auschwitz und Hiroshima, aber auch im Hinblick auf ihre Unfähigkeit
die lebensnotwendigen natürlichen Ressourcen zu erhalten, als größtes Risiko für
das Fortbestehen der Menschheit erwiesen hat.
Weder Wissenschaft noch Kunst sind heute Gegenstände bloß privater
Gelehrsamkeit oder obsessiver individueller Tätigkeit. Durch die technologische
und zivilisatorische Entwicklung sind beide längst zu wichtigen Faktoren des
wirtschaftlichen und politischen Lebens geworden. Die künstlerische
Entwicklung der letzten hundert Jahre läßt sich mitnichten aus einem erweiterten
Kunstbegriff erklären. Umgekehrt: der Begriff des Künstlerischen mußte sich
wandeln, weil das Feld der künstlerischen Praxis sich unter den Bedingungen ihrer
veränderten technischen wie ökonomischen Rahmenbedingungen erweiterte.
In Anbetracht ihrer unvermeidlichen Verstrickung in Politik und Wirtschaft ist das
Bestehen von Wissenschaftlern und Künstlern auf uneingeschränkter Autonomie,
ist ihr Beharren auf Alleinverantwortung und Garantie der Freiheit ihres Tuns
tatsächlich problematisch. Längst beschränken gesetzliche Regelungen den
Bereich wissenschaftlicher Forschung, und auch der künstlerischen Kreativität
sind Grenzen gesetzt. Was unter den Bedingungen eines autoritären Regimes die
staatliche Zensur leistet, erreichen in den liberalen Demokratien die Gesetze des
Marktes. Sie sind es, die hier verhindern oder fördern, verbieten oder erlauben.
Ein Künstler oder Wissenschaftler wird den Grad der Einschränkung seiner
Freiheit in dem Maß erleben, wie er sich im Widerspruch zu den gesetzten
Rahmenbedingungen befindet. Solange er sich mit diesen in Übereinstimmung
befindet, wird er seine Freiheit auch nicht geschmälert sehen.
Für den Künstler aber, der sich, weil er mit seiner Arbeit andere Ziele verfolgt, in
einem Widerspruch zur herrschenden Ordnung befindet, sind die Schranken, die
der Verwirklichung seiner künstlerischen Ziele gesetzt sind, existentiell. Er kann
die Grenzen, die seinen Handlungsspielraum einengen, nur dadurch überwinden,
daß er entweder die Legitimität der Grenzen in Frage stellt, oder einen gültigen
Nachweis für die Erlaubnis zum Überschreiten der Grenze vorlegt. Da Arkadien
bis heute bei keiner einzigen Regierung Botschafter akkreditiert hat, gibt es
bislang auch noch keine Dienstelle, die solche Dokumente ausstellen könnte. So
bleibt dem Künstler nichts anderes übrig, als sich sein Visum selbst zu erteilen.
Darin, so will mir scheinen, liegt der eigentliche Sinn des Dürer’schen Blattes.
Auf ihm ist sowohl die höhere Natur der Mission des Künstlers zeichenhaft
gestaltet, als auch die Perspektive des künstlerischen Unternehmens entworfen.
Kunst will, so lehrt das Blatt, dem Denken die für seine Betrachtungen
grundlegend notwendigen Anschauungen geben und damit der Erkenntnis der
Welt und des eigenen Selbst als Werkzeug dienen.
An das Ende meiner Betrachtung möchte ich aus den Schlußbemerkungen von
Hartmut Böhmes Deutung des Bildes zitieren (Im Labyrinth der Deutung –
Albrecht Dürer „Melencolia I“):
Die Deutungsgeschichte der „Melencolia I“ ist nicht zu kritisieren von einem angeblich
höheren Standort der Wahrheit aus. Vielmehr ist die Deutungsgeschichte darin ernst zu
nehmen, daß sie mit einer ungeheueren Energie Fragen nach der Bedeutung der Dinge
stellt. Dabei entsteht ein unbeabsichtigter Effekt. In der Fülle der klugen und abwegigen,
sorgfältig hergeleiteten und assoziativ bezauberten Antworten vertieft sich die
Fragwürdigkeit des Sinns und der Bedeutungen. Damit aber kehrt man zum Bild zurück.
Die Wirkungsgeschichte ist, indem sie durch immer neue Fragen die Mehrfach-
Auslegbarkeit in Gang hält, die Entfaltung des Blattes, das die Melancholie als dieses
zuletzt antwortlose Bedenken der Zeichen darstellt.
|
|
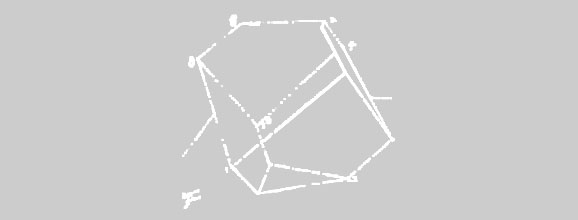 |
|
Folgerungen
Was gibt aber in unserer säkular verfaßten Gesellschaft der Kunst ihren Sinn, was
gibt dem Streben nach Erkenntnis seine Richtung? Welche Denkfiguren beleben
heute die Welt der inneren Vorstellungen?
Wie vielen meiner Generation hat sich mein Nachdenken über künstlerische
Fragen im Spannungsfeld der Auseinandersetzung um die jüngere deutsche
Geschichte und die notwendigen Lehren, die aus ihr zu ziehen seien, entwickelt.
Im Gegensatz zu dem Verdikt Adornos, daß es sich verbiete nach Auschwitz noch
Gedichte zu schreiben, war und bin ich der Meinung, daß es gerade wegen
Auschwitz und all derjenigen Verbrechen, für die dieser Name steht, notwendig ist
künstlerisch tätig zu sein. Allerdings mit dem Ziel vor Augen, Kunst und
Humanität zur Deckung zu bringen. Da Kunst in erster Linie über den Weg der
Empfindung, mehr als über den der intellektuellen Aneignung unser Bewußtsein
erreicht, ist es ihre Aufgabe, mit ihren Mitteln das menschliche Mitgefühl zu
fördern.
Ich glaube, daß sich nach den historischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts jede
Kunst überlebt hat, deren Authentizität sich von der individuellen
Leidenserfahrung des schöpferischen Subjekts ableitet. Dem Künstler, der seine
Kunst im eigenen Selbstverständnis immer noch betreibt als Sublimation seiner
eigenen schicksalhaften Individuation, mit einem Wort: als Genie (oder, was
schlimmer ist: zum Spaß), gelingt die Produktion von Kunst nur noch dem
Anschein nach. Künstler dieser Prägung spielen nur noch eine tragikomische
Rolle als makabre Widergänger kulturgeschichtlicher Heroen, als Zombies,
gesteuert von cleveren Geschäftsleuten und Bürokraten, oder als Untote in einem
medial gestützten und computerisierten Gesellschaftsspiel. Ihre Kunst aber mißrät
tatsächlich nur noch zum Abklatsch ihrer eigenen längst verrotteten
Begrifflichkeit.
Steht Dürer’s Bild an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter, so sind wir heute, so
will mir scheinen an dessen Ende angelangt. Der Bogen der Kunstgeschichte
scheint sich vollendet zu haben. Darum ist es an der Zeit grundsätzliche
Überlegungen anzustellen, ist es notwendig, über Sinn und Funktion
künstlerischer Arbeit nachzudenken. Deshalb die Rückbesinnung auf Dürer’s
„Melencolia I“.
Vereinfachend läßt sich sagen, daß Dürer’s Vorstellungen noch bestimmt waren
von der Überzeugung, daß sich in der Harmonie von Maß und Zahl die göttliche
Ordnung spiegele und, daß eine Kunst und Wissenschaft, die sich auf eine
Weltsicht gründete, in der die Prinzipien dieser höheren Ordnung herrschten, dem
Menschen sich als gut, wahr und schön erweisen müsse. Dieses Denken hat zwar
mit einem naturwissenschaftlichen Positivismus wenig gemein, aber es träumt
schon von einem Fortschritt, der aus dem forschenden menschlichen Geist
prometheische Funken schlägt. Der alte Fluchtpunkt früherer teleologischer
Perspektive, - die Suche nach der Quadratur des Kreises, - ist ersetzt durch den
zeitgemäßeren Fixpunkt, endlich die universal gültige Formel für den Gang der
Welt zu finden, das gemeinsame Gesetz, das allen energetischen Kräfte des
Universums grundlegend ist.
Das Streben aus den Bewegungsgesetzen der stofflichen Naturerscheinungen
Einsichten zu gewinnen, ja Gewißheit zu erlangen über das, was hinter den
Dingen sich verbirgt, war einst beflügelt von der Hoffnung, wissenschaftlich
operative Untersuchungen der dinglichen Welt mit einer spekulativen,
philosophisch religiösen Welterkenntnis zu einem Ganzen zu fügen.
Seit jedoch der Fortschrittsgedanke die Wissenschaft beseelt und kräftig antreibt,
ist sie ihrer alten Bestimmung mehr und mehr enthoben und richtet sich
schließlich auf den alleinigen Zweck dem Menschen als Mittel zur Beherrschung
der Natur dienlich zu sein.
Mit der Blindheit des schlimmen Aberglaubens an die empirischen
Naturwissenschaften geschlagen, stochern nun weißbekittelte Aberwitzerlinge mit
ihrer Elle im Stoff des Gewesenen. Weil ihr geringes Wissen schon ausreichte, das
Atom zu spalten, Raketen auf den Mars zu schicken, Leben in vitro zu
reproduzieren, fühlt der säkularisierte Mensch sich in seinen Allmachtsphantasien
bestätigt.
Der Mensch mag sich jedoch den Mikrokosmos und den Makrokosmos ausmessen
wie er will, am Ende allen Messens steht unveränderlich der Satz: Für den
Menschen ist der Mensch das Maß aller Dinge.
Und auch die Kunst erfüllt sich in keinem anderen, als in menschlichem Maß.
Wenn es ihre Aufgabe ist, dem menschlichen Geist Gegenstände der
Anschauungen zu geben um sein Denken zu beflügeln, und wenn es ihre Aufgabe
ist, Raum zu schaffen, wo er seine Phantasie entfalten kann, so steht für mich
außer Frage, daß Kunst eo ipso darauf abzielt, das Bewußtsein des Menschen zu
verändern. Der Künstler, der das Privileg besitzt, die Richtung seiner Tätigkeit
selbst zu bestimmen, muß sich – ebenso wie jeder Wissenschaftler – der
moralischen Verantwortung für sein Tun stellen. Er hat nicht nur die Materialität
und Funktionalität seiner Ausdrucksmittel zu prüfen, sondern ist auch hinsichtlich
der Moralität seines Wirkens Rechenschaft schuldig. Spätestens nach Auschwitz
gibt es darüber keinen Zweifel mehr.
Musikalische Prämissen
Wenn die Feststellung richtig ist, daß Kunst in erster Linie auf dem Weg der
empfindenden Wahrnehmung unser Bewußtsein erreicht, so trifft dies in
besonderer Weise auf die Musik zu. Das klanglich Lautende ist es nämlich, das
uns befähigt, unserer Wahrnehmung auch eine emotionale Wertigkeit
beizumessen. Und diese Fähigkeit hat entscheidenden Anteil an unsere
Ausstattung mit sozialer Kompetenz.
Die auf sprachlichen Ausdruck bezogene Redensart, daß der Ton die Musik
mache, will sagen, daß die Bedeutung einer Wahrnehmung sich weniger in ihrem
Was, als vielmehr in dem Wie der Lautäußerung entscheidet. Kurzgesagt: Jede
klanglich-lautende Erscheinung, also auch das Musikalische, ist ein wesentliches
Assoziativ unserer sinnlichen Wahrnehmung. Dabei handelt sich meines
Erachtens nicht um eine Eigenschaft unter anderen, sondern mit ihr ist der Kern
des Musikalischen beschrieben.
Das steht allerdings in einem krassen Widerspruch zu einer Musikauffassung, die
geschult ist an Hanslick’s ästhetischem Entwurf Vom Musikalisch-Schönen. dem
zufolge Musik nichts anderes sei, als „tönend bewegte Form“, wobei Form „sich
von innen gestaltender Geist“ sei und darum das Komponieren ein „Arbeiten des
Geistes in geistfähigem Material“. Die Aufgabe von Musik bestünde demnach
darin, Ideen darzustellen, die ihrer Natur nach „vor allem und zuerst
musikalische“ seien. Diese Tautologie führt stracks zu jener Überzeugung, daß nur
Musikalisches durch Musik gestaltet werden, und Musik nur Musikalisches
ausdrücken könne. Dieser philosophische Kurzschluß hatte eine langanhaltende
Verdunkelung des musikalischen Denkens zur Folge. Er begünstigte ein
musikalisches Fortschrittsdenken, in dessen Zentrum eine ingeniöse Erweiterung
des musikalischen Materials stand, die auf das Ziel der Emanzipation der
Dissonanz und des Geräuschs zustrebte.
Das führte bei aller Komplexität der Kompositionsmethoden in letzter
Konsequenz zu einer Homogenisierung der musikalischen Sprache, in der die
Musik ihre über Jahrhunderte gewachsene Ausdrucksfähigkeit einbüßte. Hatte
nämlich schon die Äquivalenz von Dissonanz und Konsonanz zur vollständigen
Dekomposition des Semantischen geführt, so haben schließlich die neueren
seriellen, später aleatorischen kompositorischen Verfahrensweisen zur Folge
gehabt, daß sich die Komponisten als Schöpfer ihres Werks in Frage gestellt
sahen. Weil aber noch immer der originäre schöpferische Akt im Mittelpunkt der
Vorstellung dessen steht, was Kunst sei, bemerkten sie jedoch bald, daß sie damit
an dem Ast sägten, auf dem sie saßen.
Der ungelöste Widerspruch zwischen den technischen Verfahrensweisen der
musikalischen Materialbehandlung einerseits und dem Festhalten am gewohnten
Selbstverständnis des künstlerischen Schöpfungsakts andererseits, führten sowohl
zu dem Dilemma einer musikalischen Sprache, die mit dem Redundanzverlust
ihrer Ausdrucksmittel auch ihre semantische Bedeutsamkeit verloren hat, als
auch zu einer ästhetischen Entwicklung, die im Wesentlichen unter dem
Gesichtspunkt einer technisch-innovativen Erneuerung vorangetrieben wurde.
Damit hat Musik nicht nur ihre Fähigkeit eingebüßt, als Kunst im Sinne ihres
humanistischen Auftrags wirksam sein zu können, sondern die Komponisten
haben sich solche Zielsetzung nolens volens auch selbst aus dem Kopf geschlagen.
„Ich habe gefunden“, sagte er, „ es soll nicht sein“
„Was, Adrian, soll nicht sein?“
„Das Gute und Edle“, antwortete er mir, „was man das Menschliche nennt, obwohl es gut
ist und edel. Um was Menschen gekämpft, wofür sie Zwingburgen gestürmt, und was die
Erfüllten jubelnd verkündigt haben, das soll nicht sein. Es wird zurückgenommen. Ich will
es zurücknehmen.“
„Ich verstehe Dich, mein Lieber, nicht ganz. Was willst Du zurücknehmen?“
„Die Neunte Symphonie“, erwiderte er. Und dann kam nichts mehr, wie ich auch wartete.
(aus Thomas Mann’s Doktor Faustus)
Der Gedanke der Zurücknahme, der den unvermeidlichen Verlust der
gesellschaftlichen Funktion der Musik zur heroischen Tat verklärt, grundiert bis
heute den musikästhetischen Diskurs und die Entwicklung der zeitgenössischen
Musik. Die dem institutionellen Musikleben eingeschrieben Widmung, dem
Guten, Wahren und Schönen, ist verblaßt und wird auch in der kulturpolitischen
Debatte schamvoll vermieden. Die Funktion des Musikalischen, läßt sich, so
scheint es, nur noch mit einer quantifizierenden soziologischen Methode
beschreiben und entzieht sich damit jeder ethisch moralischen Kategorisierung.
Weil ich aber davon überzeugt bin, daß Musik, wie alles Lautende, für unser
Bewußtsein konstitutiv ist, glaube ich auch, daß sie durchaus auch einem
moralischen Urteil unterliegt.
Zunächst und für sich genommen ist alle klangliche Erscheinung vollkommen
deutungslos. Erst in einem ontogenetisch komplexen, reziproken Prozeß bildet
sich in unserem Bewußtsein die Fähigkeit aus, die Wahrnehmung von Lauten zu
differenzieren und mit spezifischen Empfindungen in Verbindung zu bringen und
umgekehrt, Äußerungen mit konkreten musikalischen Lauten zu assoziieren.
Im Akt des Erinnerns rufen wir über das rein Faktische hinaus ein Empfinden
wach, das sich uns durch das klangliche Erleben eingeprägt hat. Ebenso werden in
der bloßen Wahrnehmung von Klängen, Lauten und Musik Erinnerungen
lebendig, die ursprünglich als ein synästhetisch Ganzes erlebt wurden. Umgekehrt
kommt in der rhythmisch-melodischen Agogik unseres Sprechens, aber auch im
äußeren Habitus unserer Körpersprache, unser inneres Empfinden, unser Gefühl
unwillkürlich zum Ausdruck. Damit gelange ich zu der vielleicht banal
anmutenden Feststellung, daß Musik die Sprache der Empfindung, der Gefühle,
mit einem Wort, die Sprache der Seele ist.
Eine Schlußfolgerung der Betrachtung der Dürer’schen „Melancholie“ war, daß es
Aufgabe des Künstlers sei, seine Erfindungsgabe darauf zu lenken, dem
menschlichen Geist Gegenstände zur Anschauungen zu bringen, die das Denken
beflügeln und Raum geben für die Entfaltung der Phantasie. In diesem Sinn ließe
sich sagen, daß dem Musikalischen die Funktion zukäme, die Objekte des
Denkens in Gegenstände der empfindenden Wahrnehmung zu verwandeln. Denn
erst als klangfarbige Phänomene erlangen Zeichen, Bilder und Worte in unserem
Bewußtsein ihre subjektive Bedeutung und erlebt unsere Wahrnehmung ihre
Metamorphose vom bloßen Nervenreiz zum erkennenden Gefühl oder fühlenden
Erkennen. Wie die Kunst dem Denken Anschauungen gibt, so weist Musik dem
Gefühl seine Richtung. Vom Komponieren ließe sich folglich sagen, daß es sich
bei ihm um eine Steuerungstechnologie der sensuellen Apperzeption handele. Von
dieser Einsicht war allerdings schon die Musikauffassung der camerata fiorentina
geprägt, die der Musik die Fähigkeit zuschrieb die menschlichen Affekte zu
lenken. Allerdings war diese Vorstellung noch verbunden mit dem Glauben an die
Analogie von kosmischer und seelischer Harmonie. Wenn man nicht dem
tautologischen Aberglauben verfallen ist, daß das Musikalische sich alleine im
Ausdruck des Musikalischen erfülle, so muß man der Tatsache ins Auge sehen,
daß das Musikalische immer nur Ausdruck eines außerhalb von ihm liegenden
Anderen sein kann. Das Urteil über Musik ist deshalb auch notwendig beschränkt
auf die Feststellung, ob sie ihrem Gegenstand in funktionaler Hinsicht adäquat ist.
Somit liegt auch der Zweck aller Musik in außermusikalischen Bereichen.
Deshalb entscheidet über die Moralität des musikalischen Handelns seine
außermusikalische Bindung. Oder mit anderen Worten: der Komponist hat nicht
nur Rechenschaft abzulegen über die musikalische Qualität seiner eigenen Arbeit,
sondern trägt auch Verantwortung für deren außermusikalische Bestimmung.
1 Diese Erkenntnis verdanke ich den Überlegungen und Forschungen meines Bruders Hans Florey
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|